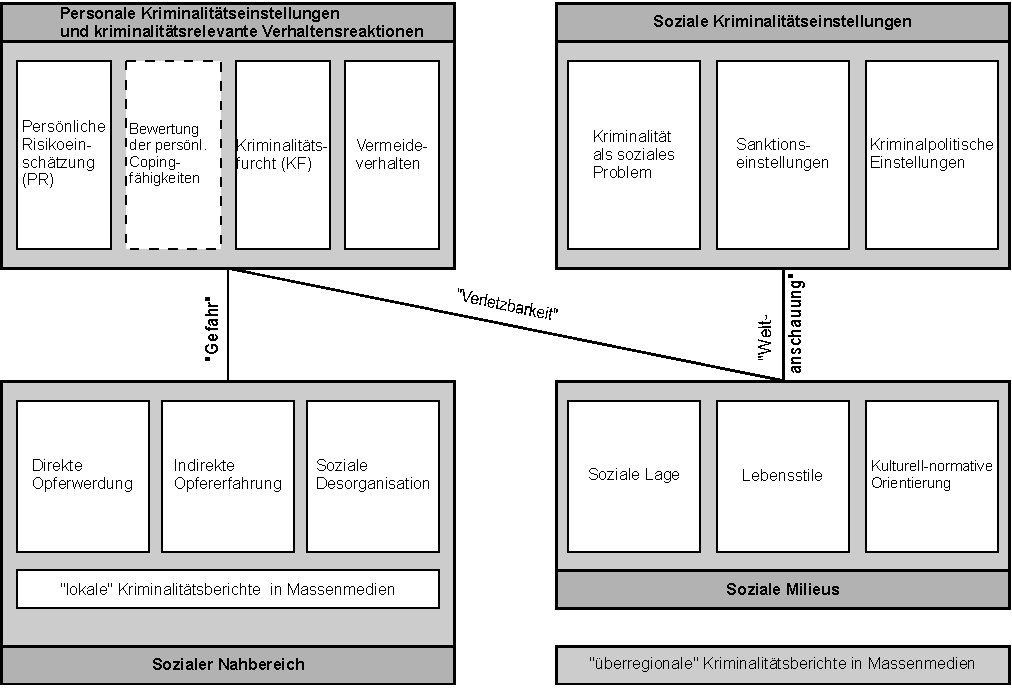
Klaus Boers/Peter Kurz
Kriminalitätsfurcht ohne Ende?
Es war einmal ein sicheres Land im Herzen Europas der achtziger Jahre. Es war geteilt, die Führungen mochten sich politisch nicht. Aber es gab eine eiserne Grenze und auf beiden Seiten viele Raketen, Panzer und Soldaten. Auch die Kriminalität, vor allem die gewaltsame, hielt sich spätestens mit Beginn der achtziger Jahre in Grenzen. In der westlichen, von reichen Ländern umgebenen Hälfte war endlich der totale Wohlstand ausgebrochen; in der östlichen gab es einfach kaum etwas zu stehlen und das wenige, das es gab, wurde schwesterlich und brüderlich geteilt. Verständlich, daß auch die Kriminalitätsfurcht keine Rolle spielte. Im Osten mußte erst gar nicht danach gefragt werden. Die durch staatliche Fürsorge überwachte und auf dem roten Plüschsofa vollzogene Zusammengehörigkeit ließ solche Gefühle nicht aufkommen. Und im Westen brachten kriminologische Weltreisende zu Beginn der siebziger Jahre die Kunde, daß im fernen Amerika richtiggehende Furchtwellen beobachtet worden seien. Dies war natürlich Grund genug, auch hier danach zu suchen. Jedoch fanden Untersuchungen in Stuttgart und Bochum oder später in Hamburg nichts so Dramatisches heraus und im Jahre 1989, am Vorabend der deutschen Einheit, fühlten sich die Bewohner unserer südlichen Hauptstadt eigentlich nur noch sicher (zum Ganzen: Boers 1991, S. 7 ff.). Kein Wunder also, daß man sich für diese Forschungen nicht sonderlich interessierte. Zwar hatten einige junge wissenschaftliche Talente schon damit begonnen, das Thema aus dem Schattendasein der Viktimologie herauszuholen (hierhin war es vermutlich zur Aufwertung der etwas spärlichen Agenda jener neuen Disziplin oder einfach auch nur deshalb geraten, weil eigentlich ja jedem kausal und damit richtig denkenden Menschen klar sein mußte, daß sich nur Opfer von Straftaten fürchten konnten). Man entwarf also weitergehende, vor allem sozialpsychologisch und soziologisch inspirierte Modelle und führte entsprechende Erhebungen durch (Arnold 1984; Schwarzenegger 1992; auch der Autor: 1991; später v.a. Bilsky 1996). Vor dem Hintergrund der amerikanischen Erfahrungen wurden dabei auch schon alle heute wieder gängigen Erklärungen und Präventionsansätze von der vermeintlichen Opferfurcht, über die durch Massenmedien und Politikerreden verunsicherte Bevölkerung bis hin zur zerbrochene Fenster reparierenden Bürgerpolizei kritisch beleuchtet, relativiert und in Frage gestellt. Wir lebten jedoch wie gesagt in einem sicheren Land, und so verloren sich solche Differenzierungsbemühungen in der unendlichen Weite jener Abteilung des öffentlichen Bewußtseins, die mit "praktisch bedeutungsloses Wissenschaftschinesisch" überschrieben ist.
Dann fiel die Mauer und bald war alles anders. In den ersten zwölf Monaten tat sich noch nicht so viel. Aber nach eineinhalb Jahren war für die ostdeutschen Großstadtbewohner die Lage endgültig unübersichtlich: Sie fühlten sich so unsicher wie manche amerikanische Großstädter zu Beginn der siebziger Jahre. Die Westdeutschen waren (auch hier?) nur zurückhaltend solidarisch und sind bis heute allenfalls so beunruhigt wie Mitte der achtziger Jahre. Nach einiger Zeit beruhigten sich die Menschen in den ostdeutschen Metropolen und anderen Großstädten indessen auch wieder, wobei allerdings in den kleineren Städten und Gemeinden erst jetzt die Unsicherheit zunahm.
Dies alles waren ungewöhnliche Auf-und-Ab-Entwicklungen. In ihnen deuteten sich die zeitliche Dichte, die schnellen Veränderungen eines sozialen Umbruchs sowie auch sich selbst regulierende Anpassungsprozesse an. Und man konnte wenn man denn wollte im Osten und Westen sozialstrukturell ganz unterschiedliche "Furchtmilieus" beobachten, deren Zusammensetzung in der Regel zumindest quer zu den liebgewonnen mono-kausalen Erklärungsansätzen lagen.
Aber, obwohl das Thema nun aktueller als in den achtziger Jahren war, interessierten solche Beobachtungen auch jetzt kaum jemanden. Denn alle hatten ein neues Thema gefunden. Natürlich die Medien, denn sie wußten schon immer: Crime pays - and best in connection with fear. Und wie so häufig mußten Politiker auf den publizistischen Druck und die Flut von Wählerbriefen reagieren. Aus Sorge um die Sicherheit der Bürger war Handlungsbedarf anzumelden und umzusetzen. Davon profitierte insbesondere die Polizei, mitunter personell, vor allem aber mit neuen Konzeptionen: Sie sollte nun bürgernah werden. Und spätestens hier konnten auch die Kriminologen nicht still halten. Es wurde sogar schon überlegt, ob die Furchtprävention nicht wichtiger als die Kriminalitätsbekämpfung sein könnte (vgl. Feltes/Gramckow 1994, S. 18). Aber auch ganz generell hatten nun viele Kriminalitätsgelehrte das Thema entdeckt. Sie schrieben, kommentierten und analysierten. Selbst kritische Kriminologen nahmen sich der Kriminalitätsfurcht als Alltagsproblem an und im SPIEGEL wurde gar empfohlen: "Die Polizei muß ran" (Sack in Heft 12/1997, S. 54). Es mußte also schlimm gekommen sein, denn vor gar nicht langer Zeit freilich im geteilten Land galt es in kritischen Kreisen noch als eher unfein, über anderes als eine durch massenmediale und politische Skandalisierung aufgewiegelte Furcht zu sprechen (vgl. Smaus 1985; Cremer-Schäfer/Stehr 1990). Der (quantitativ) empirisch Forschende galt im besten Falle als naiv, nicht bemerkend, daß er mit seinen Verlautbarungen dem herrschaftlichen Furchtprovokations- und Ablenkungsdiskurs nützte.
Irgendwie hatten es jetzt alle begriffen: Kriminalität und Kriminalitätsfurcht gehen immer. Die alten Erklärungsansätze wurden "neu" entdeckt, aktiviert und reformuliert. Und obgleich auch vor den Folgen eines "neuen Gefühls-Ansatzes" in der Kriminalpolitik gewarnt wurde (Walter 1995), stand das Verbrechensopfer wieder genauso im Mittelpunkt wie die generalisierten, aber im massenmedialen oder politischen Interesse auf die Kriminalität gelenkten sozialen Ängste. Besonders en vogue wurde die Berücksichtigung der "Community" und die Verhinderung ihres sozialen Verfalls. Kommunalpräventive Räte wurden gebildet. Sie fühlten sich immerhin der gesamten Social Factory der Gemeinde verpflichtet. Klassisch war inzwischen die Umstrukturierung der Polizei zu einer Truppe bürgernaher Schutzleute. Und im Gefolge von New York wurde gelegentlich auch schon mal "Wehret den Anfängen!" hartes Durchgreifen bei allem und jedem gefordert. Die allseitige Beliebtheit kommunaler Prävention blieb wissenschaftlich gleichwohl verwunderlich, war ihre Fähigkeit zur Furcht- und Kriminalitätsreduktion in Deutschland doch nie so recht überprüft worden und stimmten diesbezügliche anglo-amerikanische Studien eher skeptisch. Weiterführend (oder zumindest doch neuer) erschienen da schon stadtsoziologisch orientierte Studien, auch wenn die dort in Anlehnung an amerikanische Beobachtungen prognostizierten Prozesse der ethnischen Segmentierung und sozialen Exklusion etwas apokalyptisch anmuten mochten und die Visionen zukünftiger Kontrollsysteme Orwellsche Dimensionen erreichen konnten (vgl. Legnaro 1998, S. 266 ff.).
Da mußte die (mit kriminologischen Befunden übereinstimmende) Einschätzung einer kleinen Versicherung, die seit einigen Jahren und im ureigensten kommerziellen Interesse Erkundungen der subjektiven Sicherheitslage in Auftrag gegeben hatte, eigentlich irritierend wirken: "Die ohnehin nicht so stark ausgeprägte Furcht der Deutschen vor Kriminalität hat im letzten Jahr abgenommen. Die Themen innere Sicherheit und Kriminalität werden in der öffentlichen Diskussion höher bewertet, als es die subjektive Wahrnehmung von Kriminalität rechtfertigt. [...] Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Kriminalitätsfurcht häufig dramatisiert und damit instrumentalisiert wird" (R+V-Versicherung 1998, S. 1 f., Hervorhebung d. Verf.). Wenn dem so gewesen wäre, wenn die Bevölkerung also möglicherweise von selbst begonnen hätte, sich wieder sicherer zu fühlen, was sollten dann all die vielfältigen Bemühungen, gutgemeinten wie absichtsvollen Vorschläge zur Stärkung des Sicherheitsgefühls noch? Aber irgendwie brauchte man ja jetzt die Kriminalitätsfurcht ein jeder auf seine Weise.
"Zurück" zur Gegenwart: Das aktuelle Kriminalitätsfurchtniveau scheint also nicht so dramatisch zu sein, als daß man neben der Planung und Durchführung kriminalpräventiver Maßnahmen keine Zeit zu differenzierenden Beobachtungen und Analysen mehr hätte. Letzteres ist insofern bedeutsam, weil (nur) auf diese Weise für Stadtviertel und Gegenden, in denen die Kriminalitätsfurcht (vor allem noch immer in Ostdeutschland) ein Problem ist, Grundlagenkenntnisse für eine am Zusammenhang zwischen Sozialstruktur und individuellen Bewältigungsstrategien orientierte Kommunalprävention gewonnen werden können die mittel- und langfristig allein erfolgversprechende Form der Prävention.
Hierauf wird der folgende Artikel etwas näher eingehen. Nach einer zusammenfassenden Darstellung eines interaktiven Verständnismodells von Kriminalitätseinstellungen (1.) werden zunächst die in Ost- und Westdeutschland unterschiedlichen Beziehungen zwischen Kriminalitätseinstellungen und sozialen Milieus erörtert (2.). Sodann sollen erstmals Befunde über die Ausprägung kognitiver und emotionaler Einstellungskomponenten und Verhaltensreaktionen vor dem Hintergrund individueller Bewältigungsstile (Coping) vorgestellt werden (3.). Diese Analysen beruhen auf 1993 und 1995 durchgeführten ost-westdeutschen Bevölkerungsbefragungen. Auf die Grundbefunde zur Ausbreitung und Entwicklung der Kriminalitätseinstellungen seit der Wende wird hier nicht näher eingegangen (vgl. insoweit Boers/Kurz 1997; anhand der Daten der R+V-Versicherung auch Sessar 1998).
Die herkömmlichen Erklärungsansätze zur Kriminalitätsfurcht (Viktimisierungsperspektive, Soziale-Kontroll-Perspektive, Soziale-Problem-Perspektive) konnten sich empirisch allenfalls partiell bewähren. Der strukturelle Hauptmangel dieser Erklärungsansätze liegt vor allem darin, daß die Kriminalitätsfurcht vornehmlich aus dem Blickwinkel der jeweils favorisierten Untersuchungsebene (Opferwerdung; soziale Desorganisation; Problemprojektion) betrachtet wurde. Ein genaueres Verständnis ergibt sich indessen erst aus einer ganzheitlichen Sichtweise: Was als Viktimisierungsrisiko, Angst- oder Furchtemotion nur persönlich wahrgenommen bzw. empfunden werden kann, entsteht aus Anlaß bedrohlicher Erlebnisse sowie der Kommunikation hierüber im Bereich der Nachbarschaft und wird geprägt vom politisch-publizistischen Kriminalitätsdiskurs auf der gesellschaftlichen Makroebene. Dabei werden die Zusammenhänge zwischen diesen und innerhalb dieser drei analytischen Ebenen nicht kausal verstanden. Denn Ursache-Wirkungsmodelle sind nur wenig geeignet, die komplexen Beziehungen, deren struktureller und prozessualer Gesamtzusammenhang das Phänomen Kriminalitätsfurcht kennzeichnet, widerzuspiegeln. Ein theoretisches Modell zum Verständnis von Kriminalitätseinstellungen sollte demnach die kommunikativen und interaktionalen Prozesse in und zwischen diesen drei Ebenen als System-Umwelt-Beziehungen der beteiligten psychischen und sozialen Systeme (hier vor allem sozialer Nahbereich, Massenmedien, Kriminalpolitik) unter Berücksichtigung ihres jeweils selbstreferentiellen Operierens betrachten. Der in Schaubild 1 enthaltene Entwurf eines solchen Modells wird im folgenden etwas näher erläutert (ausführlicher Boers/Kurz 1997, S. 188 ff. m.w.N.).
Zunächst erscheint es bedeutsam, zwischen sozialen und personalen Einstellungsdimensionen zu unterscheiden. Es ist also zu fragen, ob jemand einen Problembereich lediglich als gesellschaftliches oder politisches Problem ansieht, oder ob er sich hiervon auch persönlich betroffen fühlt. Als soziale Kriminalitätseinstellung ist beispielsweise die Bewertung von "Kriminalität" oder "Verbrechensbekämpfung" als bedeutsames Problem "für Staat und Gesellschaft" im Rahmen eines sog. Soziale-Problem-Vergleichs zu verstehen. Auch die Sanktionseinstellungen fallen hierunter. Zu den personalen Kriminalitätseinstellungen gehören insbesondere die persönliche Risikoeinschätzung, die Kriminalitätsfurcht sowie das kriminalitätsrelevante Vermeide- und Schutzverhalten. Soziale Kriminalitätseinstellungen korrelieren in der Regel nur schwach mit personalen Kriminalitätseinstellungen. Diese Unterscheidung hat sich insbesondere auch für die Untersuchung von Medienwirkungen als sinnvoll erwiesen. Denn während zwischen dem Konsum verzerrter überregionaler Kriminalitätsberichte und personalen Kriminalitätseinstellungen allenfalls schwache Beziehungen festgestellt werden konnten, scheint ein stärkerer Zusammenhang mit sozialen Kriminalitätseinstellungen zu bestehen.
Schaubild 1: Interaktives Verständnismodell Kriminalitätseinstellungen
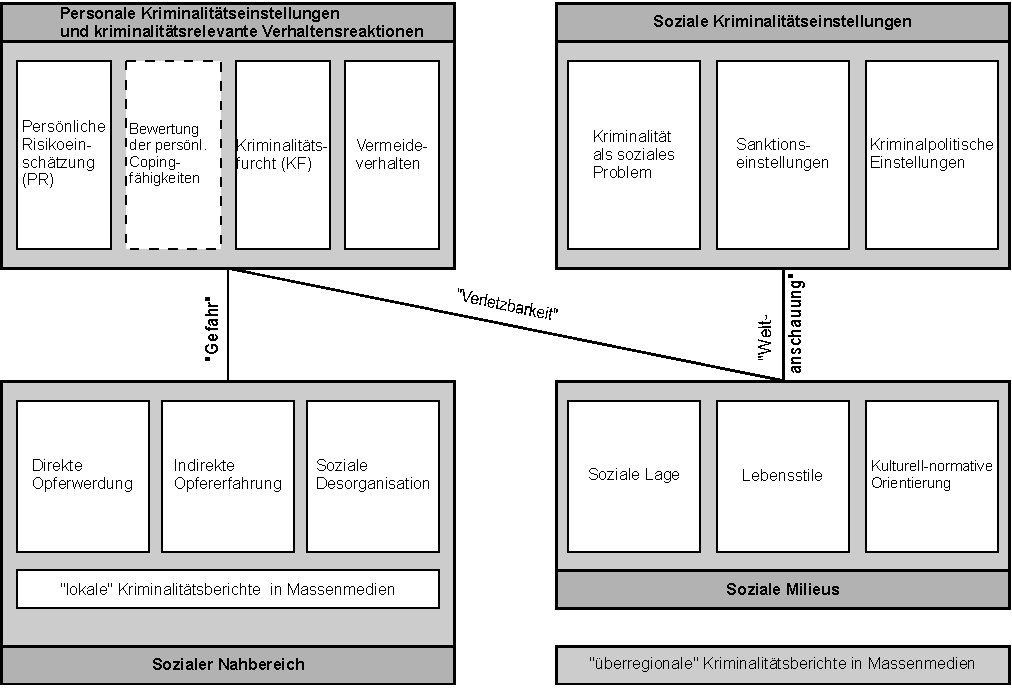
Bei den personalen Kriminalitätseinstellungen können in Anlehnung an die sozialpsychologische Attitüdenforschung zunächst kognitive (persönliche Risikoeinschätzung), affektive (Kriminalitätsfurcht) und konative (Vermeideverhalten) Einstellungskomponenten unterschieden werden. Mit dieser Unterscheidung ist freilich nichts darüber ausgesagt, wie solche Einstellungen intern, also innerhalb psychischer Systeme entstehen, sich verändern usw. Hier könnten copingtheoretische Überlegungen (Lazarus/Averill 1972) weiterführen. Danach stehen Angst oder Furcht im Zusammenhang mit zwei kognitiven Bewertungsprozessen: zum einen mit der Bewertung einer bestimmten Umweltsituation als gefahrvoll, zum anderen mit der Bewertung der persönlichen Fähigkeiten, eine solche Gefahrensituation bewältigen zu können (Bewertung persönlicher Copingfähigkeiten). Ergebnis dieser Bewertungsprozesse ist entweder das von Flucht- oder Vermeidereaktionen begleitete Furchtgefühl oder eine mit Angst einhergehende Hilflosigkeit oder schließlich eine mit aktiven Schutz- und Verteidigungsmaßnahmen korrespondierende Verärgerung oder Besorgnis (sog. Coping). Man kann diese Überlegungen also auch als ein Modell der internen Regulierung äußerer Gefahren durch psychische Systeme ansehen.
Für den ersten auf äußere Gefahrsituationen gerichteten Bewertungsprozeß kann die in kriminologischen Forschungen häufig erhobene Einschätzung des Risikos, Opfer einer Straftat zu werden (persönliche Risikoeinschätzung), verwendet werden. Da insbesondere schwerwiegende Bedrohungen relativ seltene Ereignisse sind, verläuft die persönliche Risikoeinschätzung in der Regel antizipativ, also nicht auf eine aktuelle Gefahr hin bezogen. Sie beruht ganz wesentlich auf früheren eigenen sowie vor allem auch auf vermittelten Umwelterfahrungen anderer. Es ist deshalb zu vermuten, daß diesbezügliche Kommunikationen und Interaktionen im sozialen Nahbereich (Opferwerdung, indirekte Opfererfahrung, Wahrnehmung sozialer Desorganisation, Konsum lokaler Kriminalitätsberichte in den Medien) in einem stärkeren Zusammenhang mit der persönlichen Risikoeinschätzung als mit der Kriminalitätsfurcht stehen. In Schaubild 1 weist der Begriff "Gefahr" darauf hin, daß dies die für die Entstehung von Kriminalitätseinstellungen entscheidende, dem sozialen Nahbereich zu entnehmende Information ist.
Die Bewertung der persönlichen Copingfähigkeiten gehört natürlich nicht zu den personalen Kriminalitätseinstellungen. Sie wurde jedoch an dieser Stelle (mit gestrichelter Linie) in das Modell aufgenommen, um ihre Bedeutung für den internen Regulierungsprozeß hervorzuheben. Die Bewertung der persönlichen Copingfähigkeiten wurde bislang nur unzulänglich erhoben. In der Regel wird versucht, sie indirekt als personale oder soziale Verletzbarkeit über Variablen wie Geschlecht, Alter, Bildung und soziale Schichtzugehörigkeit zu erschließen. Unter "Verletzbarkeit" wurde freilich immer mehr verstanden, als die in soziodemographischen Variablen repräsentierten sozialen Strukturen oder biologischen Merkmale. Man hoffte damit wohl auch einen Teil dessen zu erfassen, was als soziale Rolle oder als "Lebensstil" bezeichnet wird. Freilich konnte auch dies bislang theoretisch nicht näher entwickelt oder gar empirisch operationalisiert werden. Wir schlagen deshalb vor, die Bewertung der persönlichen Copingfähigkeiten einerseits unmittelbar zu erheben (unten 3.) und andererseits im Rahmen eines Konzeptes sozialer Milieus zu untersuchen (unten 2.), das im Mittelpunkt der neueren Sozialstrukturforschung steht.
Seit den Arbeiten Bourdieus (1987) zur Binnendifferenzierung des (durch kulturelles, soziales und ökonomisches Kapital strukturierten) sozialen Raumes in verschiedene soziale Milieus ("class") sowie mit den Arbeiten Becks (1986) über die "jenseits von Klasse und Schicht" verlaufenden Prozesse der Individualisierung und Pluralisierung von Lebensstilen in einer spätmodernen Risikogesellschaft wird man sich nicht mehr allein an vertikalen, auf sog. "objektiven" Merkmalen der ökonomischen und sozialen Lage beruhenden Sozialstrukturmodellen orientieren können. Denn moderne Gesellschaften zeichnen sich ebenso durch horizontale Differenzierungen aus, die vornehmlich durch kulturelle und normative Präferenzen geprägt werden. In einem Überblick von Hradil (1992, S. 31 ff.) wird demnach angenommen, daß die Struktur moderner Gesellschaften durch vier miteinander verbundene, gleichwohl für sich unabhängige, objektive und das ist die wesentliche Neuerung subjektive Faktoren gebildet wird: die
soziale Lage als "objektive" Voraussetzung mit instrumentell nutzbaren Ressourcen, vor allem Geld und Macht; mit Subkultur werden "latent-subjektive", durch Normen und Werte geprägte sozio-kulturelle Handlungsziele thematisiert; im Lebensstil verdichten sich "Entscheidungs-, Wahl- und Routinisierungsprozesse" zu eigenständigen "manifest-subjektiven" Verhaltensregelmäßigkeiten; das soziale Milieu ist schließlich als Verschränkung "objektiver" und "subjektiver" Faktoren zu verstehen, weil hierin (sozusagen als Metakategorie der drei anderen Faktoren) durch die "Wahrnehmung, Interpretation, Nutzung und Gestaltung" der "objektiven" Ressourcen im Kontext von Gemeinden, beruflicher und familiärer Umwelt "bereitstehende Handlungsvoraussetzungen zu genutzten Handlungsmitteln" werden.Da somit jeweils verschiedene soziale Lagen, Lebensstile und normative Orientierungen unterschiedliche soziale Milieus ausdifferenzieren, werden diese in unterschiedlicher Weise mit den beiden Arten von Kriminalitätseinstellungen korrespondieren. So ist, um zwei besonders bedeutsame Relevanzbereiche herauszugreifen, zum einen davon auszugehen, daß in sozialen Milieus, die einen höheren Grad an sozialer, psychischer oder physischer Verletzbarkeit repräsentieren, die persönlichen Copingfähigkeiten geringer bewertet und damit einhergehend eine stärkere Kriminalitätsfurcht geäußert sowie auch im Sinne eines Rückkopplungseffektes das persönliche Viktimisierungsrisiko als höher eingeschätzt wird. Zum anderen ist anzunehmen, daß in den kulturell-normativen Orientierungen repräsentierte weltanschauliche (politische, religiöse, philosophische) Komponenten mit entsprechenden (bspw. "restitutiven" oder "punitiven") sozialen Kriminalitätseinstellungen korrespondieren.
Dieses Modell konnte bislang leider nur in getrennten Schritten analysiert werden, da Milieudaten nur in den Befragungen des Jahres 1993 und Copingdaten nur in denen des Jahres 1995 enthalten sind. Die multivariaten Analysen wurden als multiple Korrespondenzanalysen (HOMALS) durchgeführt. Diese nicht-lineraren klassifikatorischen Verfahren erlauben eine qualitativ-explorative Analyse der in den Daten vorhandenen symmetrischen Beziehungsstrukturen, was unseren nicht kausal konzipierten Überlegungen entspricht. Die Milieubefunde wurden an anderer Stelle ausführlich dargestellt; im folgenden werden deshalb lediglich die wesentlichen Ergebnisse zusammengefaßt.
In die Analysen der Milieuzusammenhänge konnten neben den Variablen Geschlecht und Alter, die Teilbereiche Vermeide- und Schutzverhalten, sozialer Nahbereich (Viktimisierungserfahrungen, soziale Desorganisation der Nachbarschaft), Häufigkeit von Kontakten in der Familie, zu Freunden und Bekannten sowie verschiedene soziale Milieus eingebracht werden. Zur Konstruktion sozialer Milieus wurde die vertikale soziale Differenzierung anhand der sozialen Lage (Einkommen, Beruf, Bildung) sowie die horizontale soziale Differenzierung anhand kulturell-normativer Orientierungen berücksichtigt. Insgesamt ist vor allem bemerkenswert, daß in Westdeutschland die beunruhigten (wie die nicht beunruhigten) Probanden in anderen Milieukonstellationen zu finden waren als in Ostdeutschland.
So korrespondierten im Westen sozial, ökonomisch und normativ ressourcenschwache Milieus mit den sehr oder ziemlich beunruhigt-Konstellationen. In diesem multivariaten Kontext waren die demografischen Variablen Geschlecht und Alter weniger bedeutsam, mithin allein hierauf beruhende Verletzbarkeitsannahmen nicht zu stützen. Beispielsweise zeigte sich, daß ältere Probanden, die in ein normativ und sozial gefestigtes (kleinbürgerliches oder bürgerliches) Milieu eingebunden waren, keine persönliche Verunsicherung äußerten. Auf der anderen Seite gehörten Probanden mittleren Alters, die in sozial und normativ instabilen Zusammenhängen lebten (desintegrierte bzw. traditionslose Milieus), zu den Furchtsamsten. Annahmen über einen Zusammenhang zwischen persönlicher Unsicherheit und (in einem milieutheoretischen Sinne ausdifferenzierten) sozialstrukturellen Ressourcenmängeln scheinen sich also zumindest mit Blick auf die westdeutschen Befunde zu bewähren.
Für die ostdeutschen Ergebnisse war dies jedoch weniger eindeutig. Auf den ersten Blick schienen (im Einklang mit herkömmlichen Befunden) vorwiegend das Alter und Geschlecht (ältere Frauen) bei ansonsten sozialstrukturell eher stabilen Verhältnissen furchtrelevante Ressourcenmängel zu indizieren. Denn drei der vier im Osten vorgefundenen sehr bzw. ziemlich beunruhigt-Konstellationen konnten als sozial, ökonomisch sowie von ihren sozialen Netzen her als mehr oder weniger gefestigt angesehen werden. Nimmt man allerdings hinzu, daß in diesen Milieus im Unterschied zu den westdeutschen Ergebnissen konventionelle und politisch konservative Wertorientierungen überwogen und die Furchtraten in den neuen Bundesländern erheblich höher als in den alten waren, so liegt es nahe, diese ostdeutschen Furchtmilieus als umbruchsspezifische Bewältigungsmuster zu interpretieren. Die im Vergleich zu DDR-Zeiten offenbar als qualitativ neu und verschlechtert empfundene Kriminalitätssituation sowie der bereits 1993 (dem Erhebungszeitpunkt der Milieudaten) dramatisierend geführte öffentliche Kriminalitätsdiskurs scheinen insbesondere jene ostdeutschen Probanden verunsichert zu haben, die, so ist zu vermuten, an das vereinigte Deutschland einerseits stärkere Fortschritts- und Sicherheitserwartungen geknüpft haben, andererseits aber über nicht ausreichende normative Ressourcen verfügten, um die nicht erfüllten Erwartungen in ihrem persönlichen Sicherheitsgefühl flexibel zu bewältigen. Man könnte von "enttäuschten Wiedervereinigungsoptimisten" sprechen. Daß "normative Ressourcen" im sozialen Umbruch offenbar eine größere Rolle bei der subjektiven Kriminalitätsbewältigung spielen, darauf weisen (in allerdings umgekehrter Richtung) auch die Beziehungen mit dem nur wenig beunruhigten links-traditionellen Milieu hin: Denn obwohl bei diesen politischen (und in der Folge zumindest auch ökonomischen) Umbruchsverlierern eine größere Kriminalitätsfurcht nicht unerwartet gewesen wäre, wurde vor dem Hintergrund distinkter (sozialistischer) Wertorientierungen, eines (vermutlich damit zusammenhängenden) intakten sozialen Netzwerks sowie eines höheren Bildungsniveaus die Gewaltkriminalität nicht als persönliches Sicherheitsproblem bewertet (daß man die gestiegene Kriminalität gleichwohl als soziale und politische Konsequenz einer "Übernahme durch den Westen", also als gesellschaftliches Problem, betrachtet, ist davon unberührt).
Schließlich ergaben sich hinsichtlich der Zuordnung des sozialen Nahbereichs zu den einzelnen Furchtkategorien zwar keine Ost-West-Unterschiede, aber es ist gleichwohl bemerkenswert, daß unter Berücksichtigung der sozialen Milieus (auch) der Zusammenhang zwischen der Kriminalitätsfurcht und der sozialen Desorganisation nicht durch Linearität geprägt ist. Während in der Konstellation der sehr Beunruhigten noch überdurchschnittlich häufig Zeichen sozialer Desorganisation angegeben sowie Viktimisierungserfahrungen berichtet wurden, nahmen schon die ziemlich Beunruhigten in ihrem Wohnviertel kaum noch soziale Probleme wahr. Auf den ersten Blick unerwartet fand sich die häufigste Wahrnehmung von Zeichen sozialer Desorganisation in den furchtlosen Milieus der "jungen Hedonisten" und des westlichen Bürgertums (ohne daß dies im übrigen mit Opfererfahrungen einherging). Vor dem Hintergrund der, wenn auch völlig verschiedenen, Bewältigungsressourcen dieser Milieus wird dies gleichwohl nachvollziehbar: Mag die soziale Desorganisation der Nachbarschaft für die einen ein Teil des (Er-)Lebensstils, auch im Sinne von ("thrilliger") Einzigartigkeit und Authentizität, sein, so handelt es sich für die anderen um Zeichen von Auffälligkeit und Abweichung, die aufgrund bürgerlicher Distinktion zwar pointierter registriert, aber offensichtlich nicht als persönliche Bedrohung, sondern lediglich als Umweltärgernis empfunden wurden.
Die Einschätzung der persönlichen Copingfähigkeiten wurde 1995 anhand der Schilderung einer konkreten Gefahrsituation erhoben. Die vorgegebenen sechs Reaktionen wurden in einem faktorenanalytisch überprüften Coping-Index wie folgt gruppiert: aktive Copingfähigkeiten (mit dem Angreifer reden; ihn zur Seite schieben, um wegzulaufen; sich körperlich zur Wehr setzen), passive Copingfähigkeiten (zügig weglaufen; um Hilfe bitten), Hilflosigkeit.
In den Grundverteilungen fiel der in beiden (!) Landesteilen insgesamt hohe Anteil von mehr als 70% der Probanden auf, die sich in der Lage sahen, die geschilderte Gefahrsituation auf die eine oder andere Weise zu bewältigen; aktive und passive Reaktionen wurden von Westdeutschen etwas häufiger benannt als von Ostdeutschen. Zudem bestanden deutliche Zusammenhänge mit dem Alter und Geschlecht in der zu erwartenden Richtung: junge Männer verfügen über ausgeprägtere Copingfähigkeiten als ältere Frauen. Großstädter berichteten aktive und passive Bewältigungsfähigkeiten häufiger als Probanden aus kleineren Städten und Gemeinden. Diese Zusammenhänge blieben auch in der multivariaten Analyse bestehen.
In den multiplen Korrespondenzanalysen konnte neben den Copingbewertungen und allen drei Kriminalitätseinstellungskomponenten ein "Index sozialer Nahbereich", bestehend aus der Wahrnehmung sozialer Desorganisation sowie der Viktimisierungserfahrungen, berücksichtigt werden. Die Zusammenhangsstrukturen mit den Copingbewertungen waren anders als bei den Milieuanalysen in beiden Landesteilen recht ähnlich. Dies mag daran liegen, daß in die Analyse der Einschätzung der Copingfähigkeiten die sozialen Milieus nicht eingebracht werden konnten. Insoweit kann (einstweilen) nur festgehalten werden, daß außer einer im Osten etwas geringeren Verbreitung keine wesentlichen strukturellen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen beobachtet werden konnten. Aus den Analysen ergaben sich vier Beziehungsmuster, die als "aktive" und "passive" Copingfähigkeiten, "Hilflosigkeit" sowie "keine spezifischen Copingfähigkeiten" bezeichnet wurden.
Als genereller Befund läßt sich den geometrischen Ergebnisbildern der Korrespondenzanalysen die theoretisch angenommene Vermittlungsfunktion der Copingbewertung (zwischen der Wahrnehmung von Umweltgefahren einerseits und emotionaler Reaktion andererseits) entnehmen. Diese Vermittlungsfunktion wurde methodisch durch Berücksichtigung der dritten Analysedimension sichtbar und wird in Schaubild 2 mit Hilfe unterschiedlicher Schriftgrößen wiedergegeben (je größer die Entfernungen auf der Z-Achse, desto kleiner der Schriftgrad): In den jeweiligen Zusammenhangsmustern liegt die Kriminalitätsfurcht ganz vorne im Raum (größte Schrift), etwas dahinter befinden sich die Copingfähigkeiten und das Vermeide-/Schutzverhalten, ganz hinten im Raum die Risikoeinschätzung sowie der soziale Nahbereich (kleinste Schrift). Dies bedeutet, daß der soziale Nahbereich eine engere Beziehung zur Risikoeinschätzung aufweist als zu den anderen Konstrukten. Der zwischen diesem Beziehungspaar und der Kriminalitätsfurcht liegende Zusammenhang wird durch die Einschätzung der persönlichen Copingfähigkeiten vermittelt.
Schaubild 2: Multiple Korrespondenzanalyse (Homals) für Kriminalitätsfurcht und persönlicher Risikoeinschätzung (Raub), sozialer Nahbereich, Vermeide- und Schutzverhalten, Copingfähigkeiten. Alte Bundesländer 1995, n=2000.
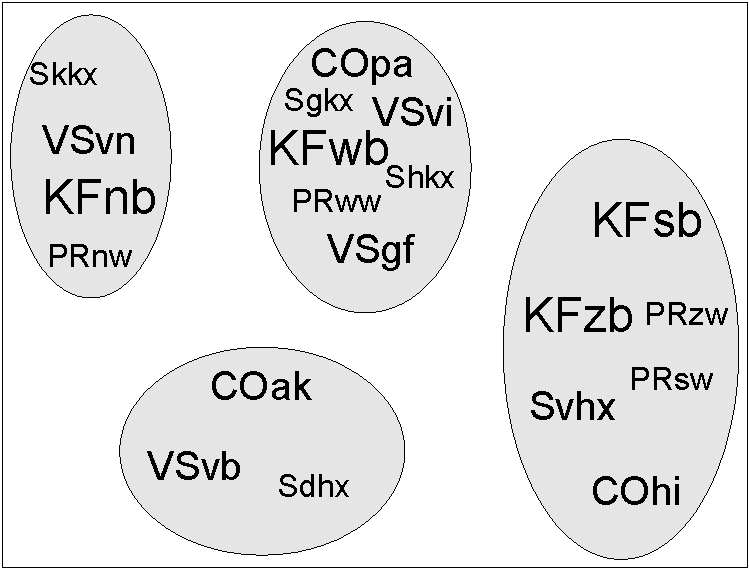
Copingfähigkeiten Coak: aktiv; Copa: passiv; Cohi: hilflos. Kriminalitätsfurcht KFsb: sehr beunruhigt; KFzb: ziemlich beunruhigt; KFwb: wenig beunruhigt; KFnb: nicht beunruhigt. Persönliche Risikoeinschätzung PRsw: sehr wahrscheinlich; PRzw: ziemlich wahrscheinlich; PRww: wenig wahrscheinlich; PRnw: nicht wahrscheinlich. Vermeide- und Schutzverhalten VSvi: vermeidet immer; VSgf: vermeidet gefahrvolle Situationen; VSvb: vermeidet bewußt; VSvn: kein Vermeideverhalten. Soziale Desorgansiation, Viktimisierung Skkx: keine soz. Des., keine Vikt.; Sgkx: geringe soz. Des., keine Vikt.; Shkx: hohe soz. Des, keine Vikt.; Sdhx: durchschnittl. soz. Des, hohe Vikt.; Svhx: hohe soz. Des, hohe Vikt.
Zur Erleichterung der inhaltlichen Interpretation der einzelnen Zusammenhangsmuster wurden die Befunde nun auch für Ostdeutschland in der folgenden Tabelle zusammengefaßt.
Tabelle: Konstellationen der Copingfähigkeiten (Kriminalitätseinstellungen bezüglich Raub). Neue (n=1.000) und alte Bundesländer (n=2.000) 1995.
|
"aktive Copingfähigkeiten" |
|
|
Ost |
WEST |
|
Vermeiden gefahrvoller Situationen, sich bewaffnen |
Vermeiden gefahrv. Situationen; s. bewaffnen |
|
Soziale Desorganisation + Viktimisierung: Keine Zuordnung |
Durchschnittliche soziale Desorganisation + häufige direkte Viktimisierungserfahrungen |
|
Kriminalitätsfurcht: keine Zuordnung |
Kriminalitätsfurcht: keine Zuordnung |
|
Risikoeinschätzung: keine Zuordnung |
Risikoeinschätzung: keine Zuordnung |
|
16-30 Jahre |
16-30 Jahre |
|
"passive Copingfähigkeiten" |
|
|
Ost |
WEST |
|
Zuhausebleiben |
Vermeiden gefahrv. Situat. od. Zuhausebleiben |
|
Höchste bzw. niedrigste soziale Desorganisation + keine Viktimisierungserfahrungen |
Geringe bis hohe soziale Desorganisation + keine Viktimisierungserfahrungen |
|
Kriminalitätsfurcht: wenig beunruhigt |
Kriminalitätsfurcht: wenig beunruhigt |
|
Risikoeinschätzung: wenig wahrscheinlich |
Risikoeinschätzung: wenig wahrscheinlich |
|
30-59 Jahre |
30-45 Jahre |
|
"Hilflosigkeit" |
|
|
Ost |
WEST |
|
Vermeide- und Schutzverhalten: keine Zuordnung |
Vermeide- und Schutzverhalten: k. Zuordnung |
|
Durchschnittliche soziale Desorganisation + keine Viktimisierungserfahrungen |
Überdurchschnittliche soziale Desorganisation + häufige Viktimisierungserfahrungen |
|
Kriminalitätsfurcht: ziemlich und sehr beunruhigt |
Kriminalitätsfurcht: zieml. u. sehr beunruhigt |
|
Risikoeinschätzung: ziemlich u. sehr wahrscheinlich |
Risikoeinschätzg.: ziemlich u. sehr wahrsch. |
|
über 45 Jahre |
über 45 Jahre |
|
"keine spezifischen Copingfähigkeiten" |
|
|
Ost |
WEST |
|
Kein Schutz- und Vermeideverhalten |
Kein Schutz- und Vermeideverhalten |
|
Unterdurchschnittliche soziale Desorganisation + häufige Viktimisierungserfahrungen |
Keine Anzeichen sozialer Desorganisation + keine Viktimisierungserfahrungen |
|
Kriminalitätsfurcht: nicht beunruhigt |
Kriminalitätsfurcht: nicht beunruhigt |
|
Risikoeinschätzung: nicht wahrscheinlich |
Risikoeinschätzung: nicht wahrscheinlich |
|
30-45 Jahre |
30-59 Jahre |
Insgesamt scheint die Einschätzung der persönlichen Copingfähigkeiten für die psychische Regulierung äußerer Gefahrsituationen eine entscheidende Rolle zu spielen: Diejenigen, die sich zu einer Reaktion in der Lage sahen, äußerten entweder nur wenig Furcht vor einem Raub (passives Coping) oder konnten hinsichtlich der Kriminalitätsfurcht und Risikoeinschätzung nicht "zugeordnet" werden (aktives Coping). Letzteres bedeutet: Hier wurden alle Kategorien der Kriminalitätsfurcht bzw. Risikoeinschätzung so gleichverteilt angegeben, daß eine Unterscheidung in die eine oder andere Richtung nicht möglich war. Daß es sich um Probanden jüngeren und mittleren Alters handelt, die an anderer Stelle der Befragung vermeidendes oder gar aktives Schutzverhalten überproportional häufig berichtet hatten, erscheint zusätzlich plausibel.
Umgekehrt äußerten die "Hilflosen" die größte Furcht und schätzten ihr Viktimisierungsrisiko am höchsten ein. Es handelte sich um Probanden mittleren und höheren Alters, die sich "passend" zur Hilflosigkeit den konkret erfragten Vermeide- und Schutzreaktionen nicht zuordnen ließen. Letzteres ist insofern bedeutsam, als in bisherigen Untersuchungen die verwendeten Operationalisierungen der Kriminalitätsfurcht mit vermeidenden Verhaltensreaktionen (stark) korrelierten, was auch darauf beruhen kann, daß die Hilflosigkeit nicht ausdrücklich erhoben wurde.
Schließlich scheint sich der inhaltliche Gesamtzusammenhang darin abzurunden, daß Probanden mittleren Alters, die ihr Wohnviertel als allenfalls nur wenig desorganisiert beurteilten, nicht beunruhigt waren, es für nicht wahrscheinlich hielten, beraubt zu werden und weder Vermeide- noch Schutzreaktionen berichteten, auch keinen spezifischen Copingfähigkeiten zuzuordnen waren.
Freilich zeigen sich insbesondere mit Blick auf die Kategorien des sozialen Nahbereichs in nahezu allen Zusammenhangsmustern einige "Ungereimtheiten", zumal im Ost-West-Vergleich. So berichteten die (nicht furchtsamen) Probanden der zuletzt erörterten Gruppe im Osten häufige, im Westen hingegen keine Opfererfahrungen. Indessen waren in Westdeutschland sowohl die hilflosen und furchtsamen Befragten als auch die aktiven "Gefahrenregulierer" häufig viktimisiert worden, nicht jedoch in Ostdeutschland. Des weiteren korrespondierten passive Copingfähigkeiten sowohl mit hoher als auch mit niedriger sozialer Desorgansiation. Sicherlich spiegelt sich in diesen Inhomogenitäten wiederum die wiederholt gemachte Beobachtung wider, daß vor allem Viktimisierungserfahrungen kaum einen linearen Einfluß auf die Kriminalitätsfurcht ausüben und deren Bedeutung deshalb in entsprechenden Analysemodellen nicht adäquat erfaßt werden kann. Gleichwohl wird man methodisch berücksichtigen müssen, daß diese Inhomogenitäten auch darauf beruhen können, daß die einzelnen Beziehungsmuster wegen der insgesamt nur wenigen Variablen, die berücksichtigt werden konnten, nicht weiter und anders auszudifferenzieren waren. Insbesondere ist zu vermuten, daß eine gleichzeitige Berücksichtigung sozialer Milieus nicht nur diesen methodischen Mangel ausgleichen, sondern vor allem inhaltlich eine genauere, sozialstrukturell orientierte Charakterisierung der einzelnen Copingstile ermöglichen würde.
Nach allem kann von einer sich weiter ausbreitenden und große Teile der Bevölkerung erfassenden Kriminalitätsfurcht, gar als Teil eines generalisierten Unsicherheitssyndroms, nicht ausgegangen werden. Dem widersprechen die inzwischen rückläufigen Entwicklungen sowie die Beobachtung, daß das Furchtniveau in Westdeutschland im europäischen Mittel liegt und auch nach der Wende bislang kaum höher als Mitte der achtziger Jahre gewesen ist. Zumindest empirisch scheint sich die Kriminalitätsfurcht also nicht ad infinitum zu entwickeln. Es besteht mit anderen Worten ein hinreichender Spielraum, um einerseits die milieubedingten Defizite, d.h. die mangelnden sozialen Copingressourcen, besonders verunsicherter Bevölkerungsgruppen genauer zu untersuchen und um andererseits die gewonnenen Erkenntnisse in eine sozialstrukturell orientierte kommunale Prävention einbringen zu können. Angesichts der komplexen, bestenfalls nur partiell steuerbaren Problemlagen heutiger Gesellschaften und vor allem ihrer Städte sind dies schwierige Aufgaben. Daher können sich Formeln solcher Art, daß "die Gemeinschaft" und der "Schutzmann an der Ecke" Sicherheit gewähren, kaum mehr als einer spontanen, von dem Wunsch nach Übersichtlichkeit geprägten Sympathie gewiß sein. Man wird sich im Jahre 9 nach der Wiedervereinigung vielleicht noch daran erinnern, daß die in diesem Jahrhundert unternommenen politischen Großversuche, vormoderne Gemeinschaftlichkeit zu bewahren, letztlich in den Differenzierungs-, Pluralisierungs- und Individualisierungsprozessen der Moderne leergelaufen sind.
Literatur
Albrecht, H.-J.: Kriminalitätsumfang, Opferrisiken und Kriminalitätsfurcht in der Schweiz, in: Kunz, K.-L./ Moser, R. (Hg.): Innere Sicherheit und Lebensängste, Bern 1996, S. 37-84.
Arnold, H.: Verbrechensangst und / oder Furcht vor Viktimisierung - Folgen von Viktimisierung?, in: Albrecht, H.J./Sieber, U. (Eds.): Zwanzig Jahre Südwestdeutsche Kriminologische Kolloquien. Freiburg 1984, S. 185-236.
Beck, U.: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt a. M. 1986.
Bilsky, W.: Die Bedeutung von Furcht vor Kriminalität in Ost und West, in: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, Jg. 79, 1996, S. 357-371.
Boers, K.: Kriminalitätsfurcht, Pfaffenweiler 1991.
ders.: Ravensburg ist nicht Washington, in: Neue Kriminalpolitik 7, H. 1, 1995, S. 16-21.
ders.: Sozialer Umbruch und Kriminalität in Deutschland, in: Monatsschrift für Kriminologie, Jg. 79, 1996, S. 314-337.
Boers, K./ Kurz, P.: Kriminalitätseinstellungen, soziale Milieus und sozialer Umbruch, in: Boers, K./ Gutsche, G./ Sessar, K. (Hg.): Sozialer Umbruch und Kriminalität in Deutschland, Opladen 1997, S. 187-253.
Bourdieu, P.: Die feinen Unterschiede, Frankfurt a. M. 1987.
Cremer-Schäfer, H./ Stehr, J.: Der Normen- und Werte-Verbund. Strafrecht, Medien und herrschende Moral, in: Kriminologisches Journal, Jg. 22, 1990, S. 82-104.
Dörmann, U.: Wie sicher fühlen sich die Deutschen?, Wiesbaden 1996.
Feltes, T.: Alltagskriminalität, Verbrechensfurcht und Polizei, in: Kriminalistik, Jg. 51, 1997, S. 538-547.
Feltes, T./ Gramckow, H.: Bürgernahe Polizei und kommunale Kriminalitätsprävention, in: Neue Kriminalpolitik, Jg. 6, H. 3, 1994, S. 16-20.
Hammerschick, W./ Karazman-Morawetz, I./ Stangl, W. (Hg.): Die sichere Stadt, Baden-Baden 1996.
Hradil, S.: Alte Begriffe und neue Strukturen, in: Hradil, S. (Hg.): Zwischen Bewußtsein und Sein, Opladen 1992, S. 15-56.
Institut für Sicherheit- und Präventionsforschung (ISIP): Innere Sicherheit: Herausforderung moderner Gesellschaften, Hamburg 1998.
Janssen, H.: Verbrechensfurcht als Kategorie sozialer Disziplinierung?, in: Ewald, U. (Hg.): Kulturvergleichende Kriminalitätsforschung und sozialer Wandel in Mittel- und Osteuropa, Bonn 1996, S. 67-70.
Kube, E.: Verbrechensfurcht - ein vernachlässigtes kriminalpolitisches Problem, in: Kühne, H.-H. (Hg.): Festschrift für Koichi Miyazawa, Baden-Baden 1995, S. 199-214.
Kury, H./ Obergfell-Fuchs, J.: Kriminalitätsfurcht in Deutschland, in: Kriminalistik, Jg. 52, 1998, S. 26-36.
Lazarus, R.S./ Averill, J. R.: Emotions and cognition: With special reference to anxiety, in: Spielberger, C. D. (Ed.): Anxiety: Current trends in theory and research, Vol. 2, New York/ London 1972, S. 242-283.
Legnaro, A.: Die Stadt, der Müll und das Fremde - plurale Sicherheit, die Politik des Urbanen und die Steuerung der Subjekte, in: Kriminologisches Journal, Jg. 30, 1998, S. 262-283.
Löschper, G.: Gewalt und Medien, in: Kriminologisches Journal, Jg. 30, 1998, S. 242-262.
Müller-Dietz, H.: Die soziale Wahrnehmung von Kriminalität, in: Neue Zeitschrift für Strafrecht 13, 1993, S. 57-65.
R+V-Versicherung: Die Ängste der Deutschen 1998, Frankfurt 1998.
Schäuble, W.: Justiz und Innere Sicherheit, in: Die CDU und die Innere Sicherheit, Bonn 1998, S. 15-20.
Schwarzenegger, C.: Die Einstellungen der Bevölkerung zur Kriminalität und Verbrechenskontrolle, Freiburg 1992.
Sessar, K.: Kriminalitätseinstellungen: Von der Furcht zur Angst?, in: Schwind, H.-D./Kube, E./Kühne, H.-H. (Hg.): Kriminologie an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Berlin/New York 1998, S. 399-414.
Smaus, G.: Das Strafrecht und die Kriminalität in der Alltagssprache der deutschen Bevölkerung, Opladen 1985.
Spellerberg, A.: Soziale Differenzierung durch Lebensstile, Berlin 1996.
Walter, M.: Von einem realen zu einem imaginären Kriminalitätsverständnis?, in: Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe 44, 1995, S. 67-73.